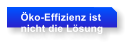Cradle to Cradle - ist Öko-Effektivität
und Upcycling die Lösung für unseren
geschundenen Planeten?



Vergiftete Gewässer, rasantes Aussterben vieler Tier- und Pflanzenarten, Zivili-
sationskrankheiten…Wir haben uns eine Hypothek aufgeladen, die wir wohl bald
nicht mehr tragen können. Obwohl Nachhaltigkeit und Recycling in aller Munde
sind, kommen wir irgendwie nicht vom Fleck. Ein Konzept, das Hoffnung macht,
ist Cradle to Cradle. Es propagiert die Freude am Produzieren, Konsumieren
und Entsorgen. Es steht für Schönheit, Überfluss und Leben, dadurch dass wir
uns die Natur zum Vorbild nehmen.
Begonnen haben die Umweltprobleme mit der sogenannten Industriellen
Revolution im 18. Jahrhundert. Dieser verdanken wir zwar, dass wir nicht mehr
mit dem Ochsengespann zur Arbeit fahren, sondern mit dem Auto. Und auch alle
sonstigen Annehmlichkeiten der modernen Zeit wie Eisenbahn und Elektrizität,
Fernsehen, Computer, Handy, Supermarkt und Shopping Mall, Urlaub per
Flugzeug (Urlaub überhaupt!) und vieles mehr.
Der Wechsel von der Agrar- zur Industriegesellschaft war aber auch der Beginn
der sogenannten “Wegwerfgesellschaft” = Take - Make - Waste (”Nimm - mach-
verschwende”)
Dass unser primär auf wirtschaftliches Wachstum ausgerichtetes Industriesystem
viel Schaden anrichtet, hat man aber sehr schnell gemerkt. Europäische Städte
waren im 19. Jahrhundert zum Teil so schmutzig, dass die Leute am Abend die
Kragen von Hemden und Manschetten wechseln mussten – eine Situation, die sich
nun an Orten wie Peking oder Manila wiederholt. Also hat man versucht, die
Industrie weniger schädlich zu machen.
Und daran arbeiten wir immer noch. Heutzutage nennt sich das Öko-Effizienz.
Unser viel zu großer ökologischer Fußabdruck soll auf Größe „Null“ schrumpfen.
Öko-Effizienz bedeutet, mehr mit weniger zu erreichen. Der Weg dorthin führt
über die berühmten drei V’s: Vermindern, (wieder-)Verwenden, Verwerten (im
Englischen die drei R’s: reduce, reuse, recycle). Doch was bedeutet das? Und ist
es wirklich eine (gute) Lösung? Nein, mehr dazu siehe ...
Öko-Effektivität – Die nächste Industrielle Revolution
„Was wäre geschehen, fragen wir uns manchmal, wenn die industrielle Revolution
in Gesellschaften stattgefunden hätte, in denen die Gemeinschaft höher geschätzt
wird als das Individuum und in denen die Menschen nicht an einen Lebenszyklus
von der Wiege bis zur Bahre glauben würden, sondern an Reinkarnation?“ – Die
sich das fragen heißen Michael Braungart, Chemiker und Professor für Chemi-
sche Verfahrenstechnik und Stoffstrommanagement, und William McDonough,
Professor für Architektur.
Ihr Menschenbild ist ein positives; sie glauben daran, dass wir mehr erschaffen
können als nur Mittelmaß und Zerstörung. Sie betrachten Schuld als schlechten
Ratgeber, denn aus Schuld entsteht keine Kreativität. Sie wünschen sich, dass wir
wieder „Eingeborene“ auf diesem Planeten werden, statt zu versuchen, uns
möglichst unsichtbar zu machen. Damit liegen sie sehr richtig, denn die Erde
wurde für uns erschaffen als unser Lebensraum und Schulzimmer.
Geht es nach Braungart und McDonough sollten die Menschen gar bestrebt sein,
einen möglichst großen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, einen an dem
sich alle Lebewesen erfreuen können. Ihre Vision ist nicht eine der Grenzen,
des Minimierens und Verkleinerns; sie sehen eine Welt der vielfältigen
Möglichkeiten, eine Welt des Überflusses und der Erneuerung.
„Wenn ein System zerstörerisch ist, sollte man nicht den Versuch machen, es
effizienter zu gestalten. Stattdessen sollte man Möglichkeiten finden, es voll-
ständig umzukrempeln, sodass es effektiv wird.“
Öko-Effektivität statt Öko-Effizienz. Statt zu probieren, die Dinge richtig zu
machen, wie es die Öko-Effizienz empfiehlt, geht es bei der Öko-Effektivität da-
rum, die richtigen Dinge zu machen. Dabei reichen kleine Kurskorrekturen nicht
aus. Der Wagen, der auf die Klippe zurast, muss ganz gewendet werden. Es ist Zeit
für eine nächste Industrielle Revolution.
„Cradle to Cradle“
Die nächste industrielle Revolution ist keine „Müsli- und Gesundheitslatschen-
Revolution“. Wachstum ist ausdrücklich erwünscht, ebenso Fülle, Überfluss und
intelligente Verschwendung. „Der Schlüssel liegt darin, nicht die Betriebe und
Systeme kleiner zu machen, wie die Fürsprecher der Effizienz es fordern, sondern
sie so zu planen und zu entwickeln, dass sie sich in einer Weise vergrößern und
verbessern, die dem Rest der Welt wieder neue Stoffe und Vorräte liefert und sie
nährt. Die „richtigen Dinge“, die Produzenten tun müssen, sind jene, die für diese
Generation der Bewohner des Planeten wie für zukünftige zu gutem Wachstum
führen – zu mehr Nischen, Gesundheit, Nahrung, Vielfalt, Intelligenz und Über-
fluss.“
Sie können sich nicht vorstellen, wie das gehen soll? Nun, eigentlich ist das Prin-
zip so alt wie die Erde selbst, denn es ist das Prinzip der Natur. Die Natur ist
nicht effizient. Drei Osterglocken pro Garten, fünf Vogelarten pro Kontinent – eine
deprimierende Vorstellung. Ein Obstbaum bringt nicht „ausreichend“ Blüten her-
vor, sondern eine verschwenderische Fülle davon. Dennoch verschwendet die Na-
tur nichts. Wenn nämlich die Blüten herabfallen, werden sie zu Nahrung für die
Bodenlebewesen und diese wiederum nähren den Baum.
Die Natur arbeitet nicht „von der Wiege zur Bahre“, sondern „von der Wiege
zur Wiege“ – Cradle to Cradle (C2C).
Braungart und McDonough schlagen vor, dass wir uns am hoch effektiven Wiege-
zu-Wiege-System der Natur orientieren, das seit Jahrmillionen unseren Planeten in
herrlicher Vielfalt und Schönheit gedeihen lässt. Die Menschen sollen die Natur
mit ihren Nährstoffströmen und Metabolismen imitieren, mehr noch, sie sollen mit
der Natur eine echte Partnerschaft eingehen. Die Natur produziert keinen Abfall,
vielmehr ist der „Abfall“ des einen Geschöpfs wieder Nahrung für ein anderes.
Natürliche Systeme entnehmen ihrer Umwelt zwar etwas, aber sie geben auch
etwas zurück. Rohstoffe werden nicht verbraucht, sondern genutzt – und damit
stehen sie wieder anderen Lebewesen zur Verfügung.
Quelle und gesamter Artikel: https://www.zeitenschrift.com/artikel/cradle-to-cradle-hoffnung-
fuer-einen-ueberlasteten-planeten
Doch wie soll das genau funktionieren? Hier einige Beispiele ...
16.11.2017