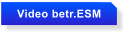Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)
Der Europäische Stabilitätsmechanismus (kurz ESM, englisch European
Stability Mechanism, französisch Mécanisme européen de stabilité) ist eine
internationale Finanzinstitution mit Sitz in Luxemburg. Er trat am 27. September
2012 mit der Hinterlegung der deutschen Ratifikationsurkunde beim
Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Kraft. Der ESM ist Teil
des ”Euro-Rettungsschirms“ und wird die Europäische Finanzstabilisierungs-
fazilität (EFSF) ablösen.Erster Geschäftsführender Direktor ist der bisherige CEO
der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), Klaus Regling.
Mit dem ESM sollen zahlungsunfähige Mitgliedstaaten der Eurozone finanziell,
unter Einhaltung wirtschaftspolitischer Auflagen (Artikel 13 des ESM-Vertrages),
mit Krediten der Gemeinschaft der Euro-Staaten unterstützt werden, wobei auch
anderen. Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Beitritt zu diesem Vertrag
offen steht (Art. 44).
Das wesentliche Instrumentarium des ESM sind Notkredite und Bürgschaften
(auch als „Haftungsgarantien“ bezeichnet): Überschuldete Mitgliedstaaten sollen
Kredite unter subventionierten Konditionen erhalten. Im ESM-Vertrag ist zudem
festgeschrieben, dass jeder Mitgliedstaat, der Hilfe durch den ESM erhält, ein
makroökonomisches Anpassungs-programm umsetzen muss sowie eine
tiefgehende Analyse über die Nachhaltigkeit seiner Staatsschuldensituation
unternehmen soll (Art. 12, Art. 13 Abs. 3 ESM-Vertrag).
Der ESM wird begründet durch den „Vertrag zur Einrichtung des Europäischen
Stabilitätsmechanismus zwischen dem Königreich Belgien, der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Estland, Irland, der Hellenischen Republik, dem
Königreich Spanien, der Französischen Republik, der Italienischen Republik, der
Republik Zypern, dem Großherzogtum Luxemburg, Malta, dem Königreich der
Niederlande, der Republik Österreich, der Portugiesischen Republik, der
Republik Slowenien, der Slowakischen Republik und der Republik Finnland“.
Dieser völkerrechtliche Vertrag wurde am 23. Januar 2012 von den
Finanzministern der Euro-Staaten beschlossen und am 2. Februar 2012 durch die
Botschafter der Mitgliedstaaten in Brüssel unterzeichnet. Inzwischen haben alle
Unterzeichnerstaaten den Vertrag ratifiziert.
Die Finanzminister der Euro-Staaten billigten zudem am 14. September 2012 in
Nikosia die vom Bundesverfassungsgericht geforderten Auflagen. Eine
entsprechende „interpretative Erklärung“ zum ESM-Vertrag hat das
Bundeskabinett am 26. September 2012 gebilligt; sie wurde am 27. September
2012 von den Unterzeichnerstaaten beschlossen. Damit trat der Gründungsvertrag
am 27. September 2012 in Kraft.
Ergänzung der Stabilisierungsmaßnahmen durch die EZB
Parallel zu den Maßnahmen des Europäischen Rates begann die Europäische
Zentralbank, Staatsanleihen gefährdeter Euro-Staaten zu kaufen (SMP). Mit dieser
Entscheidung wich die EZB von ihrem bisherigen Grundprinzip ab, niemals
Staatsanleihen von Mitgliedstaaten zu kaufen. Art. 123 AEU-Vertrag verbietet den
unmittelbaren Erwerb von mitgliedstaatlichen Schuldtiteln durch die Zentralbank
(„No Bailout“). Da die jeweiligen Staatsanleihen nicht direkt beim jeweiligen
Emittenten (nicht unmittelbar), sondern (nur mittelbar) auf dem Sekundärmarkt
von der EZB „gekauft“ wurden und weiterhin werden (Outright Monetary
Transactions) wird diese Umgehung nunmehr als rechtlich legitim kommuniziert.
Kritik am ESM-Vertrag
ESM-Vertrag ohne Austrittsrecht
Es wird kritisiert, dass der ESM auf Dauer angelegt ist und es kein Austrittsrecht
für ESM-Mitgliedstaaten gibt. Laut Völkerrecht gibt es nur die Möglichkeit zu
kündigen, wenn sich die Grundlagen insgesamt verändert haben. Im Vorfeld der
Abstimmung in Deutschland am 29. Juni 2012 über das Gesamtpaket der
Maßnahmen zur Rettung des Euro gab es unterschiedliche Auslegungen. Die
Bundesregierung vertrat die Ansicht, Interessen der einzelnen Bundesländer seien
„in Angelegenheiten des ESM nicht betroffen“ und es handle sich um einen
völkerrechtlichen Vertrag.
Souveränitätsverlust
Die Mitglieder des Gouverneursrats sind Regierungsmitglieder der jeweiligen
ESM-Mitglieder mit Zuständigkeit für Finanzen, womit nach Ansicht von
Kritikern die jeweilige Finanz-, bzw. Budget-Souveränität in Fragen des eigenen
Staatshaushaltes abgetreten wird.
Jeder Mitgliedstaat, der Hilfe durch den ESM erhält, hat ein makroökonomisches
Anpassungsprogramm umzusetzen, also wirtschaftspolitische Auflagen
einzuhalten (Art. 13). Gegenüber dem ESM ist der IWF als Gläubiger vorrangig
(Präambel des Vertrages, Seite 8, Nr. 13).
Haftung und Kapitalabruf
Haftung unbegrenzt
Kritisiert wird, dass das ESM-Kapital zunächst 700 Milliarden Euro beträgt, aber
unbegrenzt erhöht werden könne. Das ginge zwar nur mit der Stimme des
deutschen Vertreters, der allerdings an Weisungen des Parlaments nicht gebunden
ist. Der Bund der Steuerzahler schätzt es als unwahrscheinlich ein, dass der
deutsche Finanzminister sein Veto in einer entsprechenden Euro-Notsituation
einlegt. Den Bedenken wurde dadurch Rechnung getragen, dass eine solche
Veränderung erst in Kraft tritt, wenn die Mitgliedstaaten den „Abschluss ihrer
jeweiligen nationalen Verfahren“ vollzogen haben (Art. 10 Abs. 1 Satz 3).
Haftung für Anteile anderer Mitglieder
Eine besondere Brisanz liegt in der folgenden Regelung: Wenn ein Land als Zahler
ausfällt, weil es selbst finanzielle Hilfen benötigt, müssen die anderen Staaten das
– durch den Ausfall dieses Landes – fehlende Kapital zusätzlich aufbringen (Art.
25 Abs. 2 ESM-Vertrag).
Deutschland hafte für bis zu 748 Milliarden Euro, errechnete das Ifo-Institut.
Der Spiegel schrieb einen Tag vor dem ESM-Urteil des
Bundesverfassungsgerichts:
„Der als Berichterstatter zuständige Verfassungsrichter Peter Huber und seine
Kollegen brachten schon in der Verhandlung Anfang Juli vor allem gegen den
ESM immer wieder Bedenken vor: Etwa gegen den Umstand, dass Deutschland
vorübergehend das Stimmrecht im ESM entzogen werden könne, wenn es Streit
über die deutschen Zahlungspflichten gäbe. Dass der Mechanismus ausdrücklich
Nacht- und Nebel-Entscheidungen vorsieht, bei denen der Bundestag außen vor
bleiben muss. Vor allem aber, dass der ESM einen Automatismus auslösen könnte,
bei dem immer mehr Geld nachgeschoben werden muss, um die Kosten bei einem
Scheitern zu vermeiden, die aber bei der nächsten Runde dann noch höher sein
werden.“
Nachforderungsmechanismus
Kritisiert wird, dass das ESM-Management restliches Haftungskapital (derzeit bis
zu 620 Milliarden Euro) bereits mit einfacher Mehrheit nachfordern könne.
Beteiligung privater Gläubiger nur ausnahmsweise
Die Schadensbeteiligungspflichten privater Gläubiger sind dem Bund der
Steuerzahler viel zu vage. In der ESM-Vertragspräambel ist lediglich von einer
Beteiligung in „Ausnahmefällen“ die Rede.
Kreditvolumen nicht ausreichend
Der IWF und die OECD haben wiederholt gewarnt, dass die bisher geplanten
Maßnahmen des Euro-Rettungsschirms nicht ausreichen, falls große Euro-Staaten
in Schieflage geraten.
Kreditvergabe nicht transparent
Die Tatsache, dass die Vergabe von ESM-Krediten durch den Gouverneursrat
erfolgt, und hier keine objektiven, transparenten Kriterien definiert sind, wurde
kritisiert. In Artikel 34 ist geregelt, dass die Mitglieder des Gouverneursrats und
des Direktoriums sowie alle anderen Personen, die für den ESM tätig sind oder
waren, einer beruflichen Schweigepflicht, auch gegenüber dem eigenen Mitglieds-
staat, unterliegen. Einziger Entscheidungsfaktor für eine Aktivierung des ESM sei,
ob „dies unabdingbar ist, um die Stabilität des Euro-Währungsgebietes zu wah-
ren“, was als rein subjektives, politisches Entscheidungskriterium aufgefasst
wurde. Entscheidungen über die Vergabe von ESM-Mitteln sind unanfechtbar. Bei
„Gefahr in Verzug“ kann die Vergabe von Krediten und Haftungen mit qualifizier-
ter Mehrheit von 85 Prozent des Grundkapitals beschlossen werden, was kleinere
Staaten nach Ansicht von Kritikern potenziell benachteiligt.
Quelle: Wikipedia, die freie Enzyklopädie
(dort gibt es weitere Quellenangaben)