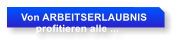Flüchtlingslager Zaatari /
Jordanien
Als Kilian Kleinschmidt als Mitarbeiter des UNHCR (Flüchtlingshilfswerk der
UNO) im März 2013 nach Jordanien geschickt wurde, um dort das Flüchtlings-
lager Zaatari zu leiten, wurde ihm gesagt, dass dieses so schwierig ist, dass
nur er das könne: „Es besteht schon seit dem Juli 2012, aber es läuft nicht
gerade rund dort“.
Gleich nach seiner Ankunft erfuhr er von Kollegen, dass es dort gefährlich ist.
Er solle besser nachts besser nicht das Camp betreten, sondern sich nur in der
„Reception Area“ für die neuen Flüchtlinge aufhalten.
Davon ließ sich aber der erfahrene und engagierte Krisenhelfer nicht abhalten.
In seinen Memoiren „Weil es um die Menschen geht“ beschreibt er das Lager
so:
„Zwölf Kilometer Luftlinie von der syrischen Grenze entfernt, ist das Lager eine
Zufluchtsstätte für alle jene, die dem in Syrien ausgebrochenen Bürgerkrieg
entkommen wollten. Nun befanden sie sich unversehens in einem neuen
„Krieg“: in einem Lagerkrieg, einem Gerangel um Hilfsgüter, die besten Plätze
im Lager, aber auch um Macht und Geld. Zehn Tage schaute ich mir genau an,
was bislang alles falsch oder auch richtig gelaufen war.
Die UNHCR – Mitarbeiter hatten es geschafft, vom ersten Tag die Grundbedürf-
nisse der Flüchtlinge zu befriedigen. Unterstützt wurden sie von mehr als
dreißig anderen permanent aktiven internationalen Hilfsorganisationen, wie
zum Beispiel OXFAM, NRC (Norwegian Refugee Council) oder ACTED (Agency
for Technical Cooperation and Development), aber auch das Deutsche Tech-
nische Hilfswerk (THW) hatte Toiletten und Gemeinschaftsküchen gebaut.
Durch das Mandat koordinierte UNHCR; das UN-World-Food-Programme war
für Lebensmittel zuständig, UNICEF für Wasser, Sanitäreinrichtungen und
Schulen usw. Die NGOs arbeiteten oft für die UNO als sogenannte
„Implementierungspartner“, quasi als Subunternehmer. Das alles funktionierte
gut. Es fehlte nicht an Lebensmitteln, an Wasser und Zelten – was keine
Selbstverständlichkeit ist, wie ich bei vielen Einsätzen erlebt habe.
Seltsamerweise wurde dennoch permanent demonstriert.“ (S.13*)
Nicht nur das. Die Flüchtlinge hatten sogar in einem Teil des Lagers
Überwachungskameras installiert, um zu sehen, ob die Polizei im Anmarsch
ist. Weiters hatten sie Gemeinschaftsanlagen demoliert wie Toiletten und
Küchen.
Kilian Kleinschmidt wollte wissen, warum die Lagerinsassen das machten.
Zuerst fand er heraus, dass die syrischen (wahrscheinlich mehrheitlich mus-
limischen) Flüchtlinge (worunter sich auch viele ehemalige oppositionelle
Kämpfer der Anti-Assad-Allianz befanden) auf die internationale Gemeinschaft
sauer waren, weil Baschar al-Assad immer noch an der Macht war. Außerdem
stellte sich heraus, dass die Mitarbeiter der vielen Hilfsorganisationen nie in
einen Dialog mit den Flüchtlingen getreten waren. Sie hatten einfach Sachen
verteilt, ohne auf ihre Fragen, Nöten und Bedürfnisse einzugehen.
Als Kilian Kleinschmidt nun zum ersten Mal nachfragte, fand er heraus, dass es
vor allem darum ging, dass die Menschen in dem Lager eine Privatsphäre
haben wollten. Er fasst seine Erkenntnisse folgendermaßen zusammen: „Alle
Programme der Hilfsorganisationen sind auf das Gemeinschaftsprinzip auf-
gebaut, aber das wollen und können die Flüchtlinge gar nicht mittragen. Im
Krieg und auf der Flucht geht es um das eigene Überleben und um das Über-
leben der Familie. Ein Mensch, der alles verloren hat, muss erst seine Indivi-
dualität und seine Würde zurückgewinnen, damit er der Gemeinschaft etwas
geben kann. Lager wie Zaatari sind zudem eine künstliche Siedlung, keine
gewachsene. Da werden Menschen einfach zusammengeschmissen, Menschen
mit ihren sozialen Unterschieden. Menschen, die sich nicht kennen, und
Menschen, die einander nicht trauen. Jeder kann ein Spitzel sein. Und
deswegen funktioniert Gemeinschaft zunächst nicht.“ (S.18*)
Vor allem bei Menschen, die ein Leben in einer Diktatur hinter sich haben. Abu
Gassem, einer der Hauptgesprächspartner im Lager, erklärte das Kilian Klein-
schmidt so: „… die meisten Südsyrer in der Daraa-Region, aus der wir kom-
men, hatten vorher viele kleine Geschäfte gehabt, mit denen sie sich über
Wasser hielten. Viele arbeiteten entweder in der Landwirtschaft oder auf dem
Bau als Handwerker oder Saisonarbeiter. Einige waren Händler, auch Schmug-
gler. Diese Lebensweise versuchen sie nun hier fortzusetzen, so gut es geht.
Sie wollen ihr eigenes Geld verdienen, wie sie es seit Generationen kennen.
(…) Das hat auch mit dem Assad-Regime zu tun. Nie haben sie einem
Menschen vertrauen können, nie wusste man, wer einen verraten würde, wenn
man das Falsche sagte. Aus diesem Grund sorgt jeder für sich selbst. Das hat
dazu geführt, dass sie keinen Respekt vor Staatsgewalten haben – oder wie
hier vor einem Campleiter. Regeln und all diese Dinge finden sie ähnlich
furchtbar wie Uniformen. Aber zugleich lieben diese Händler Zaatari, denn es
bietet eine Menge Geschäftsmöglichkeiten.“ (….) Ich kannte die Zahlen. Seit
dem 29. Juli 2012 waren 430.000 Menschen aufgenommen worden, davon
waren aber nur noch etwa 110.000 da. Abu Gassem kannte sich gut aus, denn
er war schon fast seit einem Jahr im Lager. „Viele von den Syrern haben das
Camp als Basis genommen“, fuhr er fort, „um es auf illegale Weise wieder zu
verlassen. Sie haben das natürlich nicht angekündigt, aber sie haben ihr Zelt
verkauft oder ihren Container“ – je nach finanzieller Situation eines Flüchtlings
war es auch möglich, einen Container zum Wohnen zu bekommen – „und ihre
Sachen über Hintermänner jenseits der Lagergrenzen hinauszuschmuggeln
lassen oder vorher verkauft. Und dann versuchen sie in den Dörfern und
Städten Jordaniens ihr Glück.“ (S18 ff`*).
Schließlich fasste Kilian Kleinschmidt einen Entschluss. „Zaatari muss sich
wie eine Siedlung entwickeln“, sagte er zu seinen Mitarbeitern, „mit 80.000 bis
110.000 Menschen, anders gesagt, mit 14.000 Haushalten oder 17.000 Familien.
Jeder Haushalt braucht einen Wasser- und Abwasseranschluss, jeder Haus-
halt soll einen Stromanschluss bekommen. Natürlich verbunden mit einem
Strom- sowie einem Wasserzähler“. Denn „Die Flüchtlinge wollen als Indivi-
duen wahrgenommen werden und ihre Würde zurückbekommen. Dazu gehört,
sie zur Verantwortung zu ziehen dafür, was sie nutzen. Und hat man erst diese
ganzen Versorgungssysteme, kann hier langfristig wirklich so etwas wie eine
Stadt entstehen, mit eigenen Wasser- und Stromwerken. Mit einem System zur
Abfallbeseitigung. Das kann nur nachhaltig aufgebaut werden, wenn wir das
nach wirtschaftlichen Prinzipien organisieren.“
Die Mitarbeiter von Kilian Kleinschmidt waren von der Idee begeistert. Aber:
kostet das nicht zu viel? Kilian Kleinschmidt rechnete ihnen vor: „Wenn man
zu allen Haushalten einen Trinkwasseranschluss legt, ausgeführt von vernünf-
tigen Ingenieuren, dann kostet das acht Millionen US-Dollar, vielleicht sogar
weniger. Im ersten Zaatari-Jahr haben die Tanklastwagen mit Wasser und allem
Drumherum 30 Millionen US-Dollar gekostet. Selbst wenn man jedes Jahr eini-
ges an Geld in die Verbesserung und Instandhaltung der Netze investieren
müsste, kommt man nicht auf 30 Millionen US-Dollar. Einige und immer mehr
Flüchtlinge werden zahlen können. Die Armen können mit Gutscheinen oder
sozialer Hilfe unterstützt werden.“ (S.25*)
Nötig war aber auch ein öffentliches Transportsystem, denn Dienstleistungen
in Anspruch nehmen, zu konsumieren und dafür zu bezahlen gehört zur
Menschenwürde.
Kilian Kleinschmidt erklärte das seinen Mitarbeitern so: „Wir können gut ein
öffentliches Transportsystem einrichten. Wir müssen in das Lager einen Trans-
portunternehmer hineinholen, der Busse mitbringt und der ein Geschäft damit
macht, dass er Bustickets verkauft. Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen,
zu konsumieren und dafür zu bezahlen gehört für mich zur Menschenwürde.
Genauso wie wir damit aufgehört haben, täglich Lebensmittelrationen zu ver-
teilen. Ihr habt ja gesehen, was für ein Gewinn an Lebensqualität die zwei
Supermärkte bedeuten, in denen sich die Flüchtlinge ihr Essen mit einer
Plastikgeldkarte nun selbst kaufen. Wer will schon die Bohnen essen, die auch
der Nachbar isst, wenn er für über 30 Dollar pro Person im Monat seinen Ein-
kaufskorb individuell füllen kann? So werden die Menschen vom Almosen-
empfänger zum Happy-Shopper – für genau den gleichen finanziellen Aufwand.
Das möchte ich auch in Richtung Kleidung und Hygieneartikel haben.“ (S.26*)
Die Mitarbeiter waren einverstanden. Widerstand kam jedoch vom UNHCR.
Dort dauerte es ein Jahr, bis die Entscheider verstanden hatten, dass der
vorgeschlagene Weg von Kilian Kleinschmidt nachhaltiger war als die bis-
herige Vorgangsweise.
Als Partner für die Planung kam dann die Stadt Amsterdam zu Hilfe und
schickte ihre Experten und Städteplaner.
Aber auch im Lager musste sich Kilian Kleinschmidt durchsetzen und sich als
„Alphatier“ gegenüber den vielen „Chefs“ beweisen, die die Macht im Lager an
sich gerissen hatten wie zum Beispiel Abu Hussein, ein ehemaliger Komman-
deur einer Spezialeinheit der Freien Syrischen Armee (Kilian Kleinschmidt
erzählte er, dass er mit Minen insgesamt 73 Menschen getötet hatte, bevor ihn
die Angst gepackt, über die Grenze geflohen und schließlich in Zaatari
gelandet war).
Als nächstes musste Kilian Kleinschmidt Vertrauen aufbauen: „Deswegen
versuchten mein Team und ich auch nur das durchzusetzen, was längerfristig
machbar war. Und das kommunizierten wir auch mit aller Ehrlichkeit: „Für
diese Sache brauchen wir sechs Monate, für jene ein Jahr.“ So benötigten wir
eine Weile, um die Seitenstraßen der Champs-Elysée ansehnlich zu machen,
sie sollten nicht mehr so schlammig sein, auch wäre eine neue Drainage not-
wendig. Als die Anführer sahen, dass wir ihre berechtigten Ansprüche in die
Tat umsetzten, kooperierten sie mehr und mehr mit uns. Aber immer wieder
mussten wir ihnen ihre Grenzen vor Augen halten. Sie kapierten sogar, dass
die Umspanngeräte auch deshalb wieder und wieder kaputtgingen, weil zu viel
Strom abgezapft wurde, und dass deshalb dieses Vorgehen zu reduzieren
wäre. (…)
Es lebe der Unterschied – das war unsere wichtigste Erkenntnis. Auf der einen
Seite gab es Ende 2014 im Lager fast 3000 Geschäfte mit einem Umsatz von
mehreren Millionen US-Dollar, auf der anderen Seite waren die humanitären
Helfer damit überfordert, dass die Flüchtlinge einen ganz eigenen Kopf hatten
und viele ihrer Forderungen mal mehr, mal weniger gewaltsam durchdrückten.
Die Scharen von Kindern ohne Familienstruktur und soziale Kontrolle waren
ausgesprochen gefährlich, wenn sie anfingen Steine zu werfen. Klar, dass es
da knallen musste. Manche hatten bis zu 30.000 US-Dollar in ihre Container-
häuser investiert, andere bis zu 200,000 US-Dollar in illegale Supermärkte, die
aus Teilen auseinandergebauter Wohncontainer errichtet worden waren.
Gemeinschaft war zunächst unerwünscht, wie ich nun wusste, stattdessen
wurde Individualität großgeschrieben. So konnten wir keinen Einfluss darauf
nehmen, wie die Zelte aufgestellt wurden. Wir hatten versucht, sie in Reihen
aufzuschlagen, ganz klassisch, ganz typisch – Siteplaning nennt sich das ...
Zaatari wird von vielen immer wieder als Modell für moderne
Lagerentwicklung bezeichnet, doch UNHCR und die jordanische
Regierung hatten gemäß Kilian Kleinschmidt die falschen Lehren daraus
gezogen, aus Angst vor einem weiteren „Chaos“: „So wurde schon 2013 ein
zweites Lager in Jordanien errichtet, da man mit weiter steigenden Flüchtlings-
zahlen rechnete. Über 90 Millionen US-Dollar wurden investiert in einem auf
dem Reißbrett geplanten Lager mit fest in den Boden verankerten Blechhütten,
damit sie keiner bewegen oder gar klauen konnte; es wurden keine Straßen-
laternen aufgestellt und kein Strom geliefert, damit man ihn nicht stehlen
konnte. Und einen Markt durften die Flüchtlinge zunächst auch nicht ein-
richten, sowieso keinen selbst organisieren. Zwar hatte man das Lager in
„Dörfer“ aufgeteilt, aber es gab keine Möglichkeit der Selbstgestaltung. Azraq
wurde zunächst zum Abstelllager – Zaatari ist zu einem dynamischen Lebens-
raum geworden.”
Lager sind jedoch gemäß Kilian Kleinschmidt auch vom UNHCR
nicht mehr erwünscht. Da aber die Flüchtlingshilfe stets mit den jeweiligen
Regierungen zusammenarbeitet und diese eher gängige Lager wünschen, um
Kontrolle ausüben zu können, muss oft ein Kompromiss gefunden werden ....
Blockiert wird von den Regierung aber oft auch die Arbeitserlaubnis für
Flüchtlinge, was dazu führt, dass diese in die Illegalität gedrückt werden.
Außerdem wird dadurch Kinderarbeit gefördert. Kilian Kleinschmidt plädiert
daher dafür, Flüchtlingen Arbeitserlaubnis zu erteilen. Denn davon würden im
Endeffekt alle profitieren …







*) Kilian Kleinschmidt, “Weil es um die Menschen geht”
Econ-Verlag, Berlin 2015, S.33ff.


Zaatari liegt im Norden Jordan-
iens, etwa 10 km östlich von
Mafraq und sechs Kilometer
südlich der syrischen Grenze.
Es ist eines der weltgrößten
Flüchtlingslager und entwickelt
sich zu einer festen Siedlung;
so gibt es etwa eine Haupt-
straße mit Marktständen und
Läden, genannt „Champs-
Élysées“. Inzwischen ist es
Jordaniens viertgrößte Stadt..